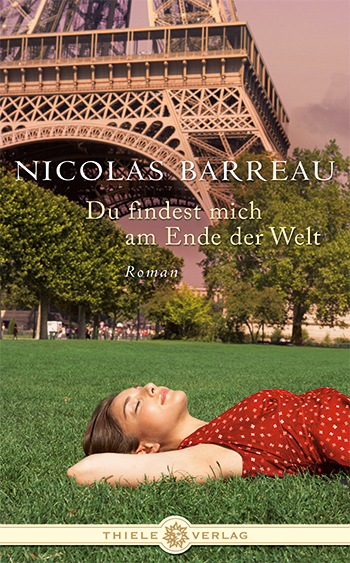
über 200 Seiten im Format 11,5 x 18,5 cm
Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen
WG 1110
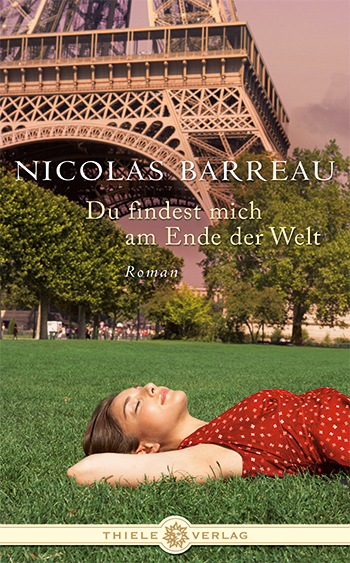
über 200 Seiten im Format 11,5 x 18,5 cm
Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen
WG 1110
Jean-Luc Champollion – für alle seine Freunde nur »Jean-Duc« – ist das, was die Franzosen einen homme à femmes nennen. Bei den Damen hat der charmante Galerist leichtes Spiel. Und wenn es nach ihm ginge, könnte das Leben an der Seite seines treuen Dalmatinerhundes Cézanne immer so weiter gehen. Doch ein Brief, den Jean-Luc eines Morgens aus seinem Briefkasten zieht, bringt ihn in eine ganz neue Umlaufbahn. »An den Duc« steht auf dem mit blaßblauer Tinte beschriebenen Couvert.
Es ist ein Liebesbrief, ohne Zweifel. Ein überaus bezaubernder Liebesbrief sogar. Aber wer hat ihn geschrieben? Und wieso bedient sich die Verfasserin einer Sprache, die dem neunzehnten Jahrhundert zu entstammen scheint, und unterzeichnet hoheitsvoll mit »Die Principessa«?
Jean-Luc ist verwirrt. Doch er beschließt, sich auf das Spiel der Principessa einzulassen und antwortet an eine E-Mail-Adresse, die in dem Brief genannt wird. Um jeden Preis will er die Identität der geheimnisvollen Fremden aufdecken, die sich einen Spaß daraus macht, ihn im Ungewissen zu lassen, und die doch einiges über ihn zu wissen scheint.
Mit einem Mal sieht der Galerist alle Frauen in seiner Umgebung mit anderen Augen. Wie ein Detektiv durchforstet Jean-Luc sein Leben, geht den Hinweisen nach, die er in den Briefen zu finden glaubt, und merkt nicht, dass er auf dem besten Weg ist, sich zu verlieben. Wirklich zu verlieben – in Worte, Gedanken und Phantasien. In die Frau, deren Wesen er bald besser kennt als die Bilder in seiner Galerie, und die er noch nie gesehen hat. Oder doch?
Ein geheimnisvoller Brief.
Ein amouröses Verwirrspiel.
Eine Geschichte, zum Verlieben schön.
Nicolas Barreau hat sich mit seinen im Thiele Verlag erschienenen Romanen Die Frau meines Lebens, Du findest mich am Ende der Welt und Eines Abends in Paris ein begeistertes Publikum erobert. Sein Buch »Das Lächeln der Frauen brachte ihm den internationalen Durchbruch, es erschien in 36 Ländern, war in Deutschland mit weit über einer Million verkauften Exemplaren »Jahresbestseller 2012“ und wird seit drei Jahren in unterschiedlichen Inszenierungen an deutschen Theatern gespielt.
Amüsant und locker erzählt.
Eine Geschichte, zum Verlieben schön!
Unbeschreiblich romantisch, gefühlvoll, atemberaubend und zum Heulen schön!
Was für eine herrliche Liebesgeschichte!
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte ich das Gefühl, ein Hammer wäre mir auf den Kopf gefallen. Es ist immer dieses eine Glas zuviel, das man später bereut.
Stöhnend drehte ich mich zur Seite und tastete nach dem Wecker. Es war Viertel nach zehn, und das war schlecht, sehr schlecht sogar. In einer Stunde würde Monsieur Tang, mein kunstbegeisterter Chinese, an der Gare du Nord ankommen, und ich hatte versprochen, ihn vom Zug abzuholen.
Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke war Charlotte. Ich drehte mich um und blickte auf ein zerwühltes Laken, auf dem keine Frau lag. Überrascht setzte ich mich auf.
Charlotte war weg, ihre Kleider, die sie gestern nacht laut singend in meiner Wohnung verstreut hatte, waren verschwunden.
Seufzend ließ ich mich für einen Moment ins Kissen zurücksinken und schloß die Augen. Mon Dieu, und was für eine Nacht! Selten hatte ich eine Nacht mit einer Frau verbracht, in der ich so wenig geschlafen hatte und in der so wenig passiert war.
Ich wankte in die Küche, wo mich Cézanne mit freudiger Ungeduld begrüsste, füllte ein großes Glas mit Wasser und durchsuchte den Vorratsschrank nach Aspirin. »Ist ja gut, mein Alter, wir gehen gleich Gassi «, versprach ich. Cézanne bellte und wedelte mit dem Schwanz. »Gassi« war das einzige Wort, auf das er immer reagierte. Dann schnüffelte er an meinen nackten Beinen und legte den Kopf schief.
»Tja, die Dame ist schon weg«, sagte ich und ließ drei Aspirin in das Glas fallen. In Anbetracht meiner Verfassung und der wenigen Zeit, die mir noch blieb, war ich nicht ganz unfroh darüber.
Als ich ins Bad ging, sah ich als erstes den Zettel, der am Spiegel klemmte.
Mein lieber Jean-Duc, läßt du die Frauen immer so lange warten, bis sie einschlafen?
Ich hab noch einen bei dir gut, vergiß das nicht! A tout bientôt ... Charlotte
Darunter hatte sie einen kleinen Lippenstiftkuß gesetzt.
Ich grinste, nahm den Zettel herunter und warf ihn in den Papierkorb. In der Tat zählte die letzte Nacht nicht gerade zu den erotischen Höhepunkten meines Lebens.
Während ich mich rasierte, mußte ich daran denken, wie die betrunkene Charlotte hinter mir in die Wohnung gestolpert war und erst einmal über Cézanne stürz te, der ihr bellend zwischen die Füsse lief. Ich wollte ihr gerade aufhelfen, da zog sie mit einem Ruck an meinem Hosenbein, und ich landete neben ihr auf dem Teppich. »Aber Monsieur Champollion, nicht so stürmisch!«
Sie lachte, und ihr Gesicht war plötzlich verwirrend nah. Charlotte schlang die Arme um meinen Hals und drückte mir einen heißen Kuß auf den Mund.
Ihre Lippen öffneten sich, und ich fand die Idee mit dem Bonbon plötzlich ziemlich verlockend und griff in ihr volles, dunkles Haar, das nach Samsara duftete. Lachend und schwankend schafften wir es bis ins Schlafzimmer. Das crèmefarbene Kostüm blieb bereits im Flur zurück.
Ich knipste die kleine Lampe auf dem Vertiko an, die den Raum in ein sanftes gelbliches Licht tauchte, und drehte mich zu Charlotte. Sie schwenkte herausfordernd ihre Hüften und sang »Voulez-vouz coucher avec moi ... ce soiiiir«. Dann warf sie übermütig ihre Seidenstrümpfe durch die Luft. Einer schwebte zu Boden, der andere blieb an einem Kinderbild von mir hängen, das auf dem marmornen Kaminsims steht, und legte einen anmutigen Schleier über das Gesicht des schlaksigen, blonden Jungen mit den blauen Augen, der stolz sein erstes Fahrrad am Lenker hielt und in die Kamera lachte.
Charlotte ließ sich in ihren zarten maronenfarbenen Dessous, die der Politikergatte offenbar nicht genügend würdigte, auf mein Bett fallen und streckte die Arme nach mir aus. »Viens, mon petit Champollion, komm her zu mir«, säuselte sie, es klang wie »Champignon«, aber auch dagegen hatte ich nichts einzuwenden. »Komm her, mein Süsser, ich zeige dir jetzt den Stein von Rosette ...« Sie räkelte sich auf der Bettdecke, strich über ihren schlanken Körper und schenkte mir ein mutwilliges Lächeln.
Wie hätte ich da widerstehen können? Ich bin auch nur ein Mann.
Wenn ich dennoch widerstand, so geschah dies unfreiwilligerweise, denn in dem Moment, als ich mich über sie beugte, um mit sanfter Hand mein archäologisches Abenteuer zu beginnen, klingelte mein Handy.
Ich versuchte, es zu überhören, flüsterte meiner schönen Nofretete kleine Schmeicheleien ins Ohr, küsste ihren Hals, aber wer auch immer mich da mitten in der Nacht zu erreichen versuchte, er ließ nicht locker, und das Klingeln wurde immer drängender.
Plötzlich hatte ich beängstigende Visionen von Unfalltoten und Schlaganfallopfern.
»Entschuldige mich einen Moment.« Seufzend löste ich mich von der leise protestierenden Charlotte, ging zu dem weinroten Sessel hinüber, auf den ich achtlos Jacke und Hose geworfen hatte, und kramte das Handy aus der Tasche.
»Oui, hallo?« stieß ich leise hervor.
Eine tränenerstickte Stimme antwortete.
»Jean-Luc? Jean-Luc, bist du es? Bin ich froh, daß ich dich erreiche. Warum bist du nicht drangegangen? Oh, mein Gott, Jean-Luc!« Die Stimme am anderen Ende der Leitung schluchzte auf.
Oh, mein Gott, dachte auch ich. Bitte nicht jetzt! Es war Soleil. Ich verfluchte mich einen Moment dafür, daß ich nicht auf mein Display geschaut hatte, aber ihr Schluchzen klang dramatischer als sonst.
»Soleil, Liebes, beruhige dich doch. Was ist denn los?« sagte ich vorsichtig. Vielleicht war ja wirklich etwas passiert, und es war nicht nur eine dieser verzweifelten künstlerischen Schaffenskrisen, die immer dann auftraten, wenn wir den Termin für eine Ausstellung festgelegt hatten.
»Ich kann nicht mehr«, heulte Soleil. »Ich male nur noch Scheiße. Vergiß die Ausstellung, vergiß alles! Ich hasse meine Mittelmäßigkeit, dieses ganze mediokre Zeug hier ...« Es klang, als trete jemand gegen einen Farbeimer, und ich kniff die Augen zusammen, als das Scheppern mein Ohr erreichte. Ich konnte die schlanke hochgewachsene Gestalt direkt vor mir sehen, mit den großen dunklen Augen und den schwarzglänzenden Locken, die wie dunkle Flammen um ihr schönes milchkaffeebraunes Gesicht züngelten und Soleil, einziger Tochter einer schwedischen Mutter und eines karibischen Vaters, in der Tat etwas von einer schwarzen Sonne gaben.
»Soleil«, sagte ich mit der ganzen zen-buddhistischen Beschwörungskraft, derer ich fähig war, und spähte unruhig zum Bett hinüber, wo Charlotte sich interessiert aufgesetzt hatte. »Soleil, das ist doch alles Unsinn. Ich sage dir, du bist gut. Du bist ... du bist großartig, wirklich.
Du bist einzigartig. Ich glaube an dich. Hör mal ...«, ich senkte meine Stimme ein wenig, »es ist jetzt gerade wirklich schlecht. Warum legst du dich nicht einfach ins Bett, und morgen komme ich vorbei, und ...« »Soleil? Wer ist Soleil?« lallte Charlotte lautstark aus dem Schlafzimmer.
Ich hörte, wie Soleil am anderen Ende der Leitung die Luft einzog.
»Ist da eine Frau bei dir?« fragte sie mißtrauisch.
»Soleil, bitte, es ist mitten in der Nacht, hast du mal auf die Uhr geschaut?« entgegnete ich beschwörend, ohne auf ihre Frage einzugehen. Ich winkte Charlotte beruhigend zu und preßte den Hörer dicht an meine Lippen. »Laß uns das morgen in Ruhe bereden, ja?« »Warum flüsterst du so?« schrie Soleil aufgebracht, dann fing sie wieder an zu schluchzen. »Klar hast du eine Frau bei dir, die Weiber sind dir ja immer wichtiger.
Alle sind wichtiger als ich. Ich bin ein Nichts, nicht mal mein Agent interessiert sich für mich« - das war ich - »und weißt du, was ich jetzt mache?«
Ihre Frage hing in der Luft wie eine Bombendrohung.
Hilflos lauschte ich in die schreckliche Stille, die plötzlich entstanden war.
»Ich nehme jetzt diese schwarze Farbe hier ... und übermale alle meine Bilder!«
»Nein! Warte!« Ich gestikulierte zu Charlotte hinüber, daß es ein Notfall und ich gleich wieder bei ihr wäre, und zog seufzend die Tür des Schlafzimmers hinter mir zu.
Fast eine Stunde dauerte es, bis ich die rasende Soleil wieder einigermaßen beruhigt hatte. Es war ja, so erfuhr ich, während ich unruhig im Flur auf und ab lief und die Holzbohlen unter meinen Füssen knarrten, nicht nur der künstlerische Selbstzweifel, wie ihn jeder mal erlebt. Soleil Chabon war unglücklich verliebt, in wen, könne sie mir nicht sagen, unter keinen Umständen. Es sei alles hoffnungslos. Der Liebesschmerz jedenfalls nähme ihr jegliche Inspiration, sie sei Expressionistin und die Welt nunmehr ein schwarzes Grab.
Irgendwann hatte sie sich müde geredet. Als ihre Schluchzer leiser wurden, schickte ich sie mit sanfter Stimme zu Bett. Mit dem Versprechen, daß alles gut würde und daß ich immer für sie da wäre.
Es war kurz nach vier, als ich mit tauben Füssen wieder ins Schlafzimmer zurückschlich. Mein nächtlicher Besuch lag quer über dem Bett und schlummerte friedlich wie Dornröschen. Vorsichtig schob ich die leise schnarchende Charlotte ein Stückchen zur Seite. »Schlafen«, murmelte sie, umklammerte ihr Kopfkissen und rollte sich zusammen wie ein Igel.
Vom Stein von Rosette war keine Rede mehr. Ich löschte das Licht, und wenige Minuten später fiel auch ich in einen traumlosen Schlaf.
Die Kopfschmerztabletten begannen zu wirken. Ich stürzte noch einen Espresso hinunter, und als ich mit Cézanne an diesem denkwürdigen Donnerstagmorgen die Treppen hinunterlief, ging es mir eigentlich schon wieder ganz gut.
Es gibt Menschen, die behaupten, daß sich die grundstürzenden Veränderungen im Leben auf irgendeine Weise ankündigen. Daß es immer Zeichen dafür gibt, die man nur sehen muß.
»Ich hatte schon den ganzen Morgen so ein komisches Gefühl«, sagen sie, nachdem etwas Einschneidendes geschehen ist. Oder: »Als das Bild plötzlich von der Wand fiel, wußte ich, daß etwas passieren würde.« Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß mir diese geheimnisvollen esoterischen Antennen offenbar fehlten.
Natürlich würde ich im nachhinein gerne behaupten, daß der Tag, der mein ganzes Leben so völlig auf den Kopf stellte, irgendwie besonders war. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben - ich ahnte nichts.
Ich hatte keine Vorahnung, als ich den Briefkasten unten im Eingangsflur aufschloß. Ja, nicht einmal, als ich unter einigen Rechnungen den blaßblauen Umschlag entdeckte und hervorzog, regte sich mein siebter Sinn.
Auf dem Kuvert stand in einer schön geschwungenen Handschrift »An den Duc«. Ich weiß noch genau, daß ich amüsiert lächelte, weil ich annahm, daß die entschwundene Charlotte mir auf diese Weise einen kleinen Abschiedsbrief zukommen ließ. Nicht einen Augenblick machte ich mir darüber Gedanken, daß auch Damen der Gesellschaft wohl kaum stets und überall Büttenbriefpapier in ihren Handtaschen mit sich herumtragen.
Ich wollte gerade den Umschlag aufreißen, als Madame Vernier mit einer Einkaufstasche in den Hausflur trat. »Bonjour, Monsieur Champollion, hallo, Cézanne«, begrüsste sie uns freudig. »Na, Sie sehen aber aus, als hätten Sie nicht viel geschlafen - ist wohl spät geworden gestern?«
Madame Vernier ist meine Nachbarin und wohnt allein in einer riesengroßen Wohnung im Parterre. Seit drei Jahren reich geschieden, lebt diese Dame nahezu anachronistisch entspannt im Hier und Jetzt. Sie ist auf der Suche nach Ehemann Nummer Zwei. Das hat sie mir jedenfalls gesagt. Aber auch das hat natürlich keine Eile.
Das Gute an Madame Vernier ist, daß sie unglaublich viel Zeit hat, sehr tierlieb ist und sich um Cézanne kümmert, wann immer ich unterwegs bin. Das Schlechte an ihr ist, daß sie unglaublich viel Zeit hat und einen in stundenlange Gespräche verwickelt, wenn man es eilig hat.
Auch an diesem Morgen stand sie vor mir wie frischgefallener Schnee. Ich blickte nervös in ihr freundliches, ausgeschlafenes Gesicht.
Kam es mir nur so vor, oder schielten ihre Augen schon interessiert nach dem himmelblauen Kuvert in meiner Hand? Ehe sie mich in eine Unterhaltung über aufregende Nächte oder handgeschriebene Briefe verstricken konnte, steckte ich meine Post hastig in die Tasche.
»In der Tat, in der Tat, es war ziemlich spät«, konzedierte ich und warf einen Blick auf meine Uhr. »Himmel, ich muß los, sonst verpasse ich meinen Termin!
Bonne journée, Madame, bis später!« Ich hastete zum Eingangsportal, schleifte Cézanne hinter mir her, der noch an Madame Verniers zierlichen Schuhen schnüffelte, und drückte auf den TüroÅNffner.
»Ihnen auch einen schönen Tag!« rief sie mir nach. »Und sagen Sie ruhig Bescheid, wenn ich Cézanne mal wieder nehmen soll. Sie wissen ja, ich habe Zeit.« Ich winkte und lief los, Richtung Seine. Cézanne mußte endlich zu seinem natürlichen Recht kommen. Zwanzig Minuten später saß ich in einem Taxi, das mich zur Gare du Nord bringen sollte. Wir hatten den Pont du Caroussel überquert und fuhren gerade an der Glaspyramide vorbei, die sich im Glanz der Morgensonne spiegelte, als mir der Brief von Charlotte wieder einfiel.
Lächelnd zog ich ihn hervor und öffnete den Umschlag. Die Dame war ganz schön hartnäckig. Aber charmant. Im Zeitalter von E-Mail und SMS hatte ein handgeschriebener Brief geradezu etwas rührend Altmodisches, ja Intimes. Abgesehen von den Urlaubspostkarten meiner Freunde war es lange her, daß ich eine solch private Post in meinem Briefkasten vorgefunden hatte. Ich lehnte mich zurück und überflog die beiden Seiten mit der feingeschwungenen Schrift. Dann setzte ich mich so abrupt auf, daß der Taxifahrer neugierig in den Rückspiegel sah. Er bemerkte den Brief in meiner Hand und zog seine eigenen Schlüsse.
»Tout va bien, Monsieur? Alles in Ordnung?« fragte er mit dieser ganz speziellen Mischung aus unverblümter Anteilnahme und nahezu allwissender Menschenkenntnis, die Pariser Taxifahrer auszeichnet, wenn sie ihren guten Tag haben.
Ich nickte verwirrt. Ja, alles war in Ordnung. Ich hielt einen wunderbaren Liebesbrief in meinen ratlosen Händen. Er war an mich gerichtet, ohne Zweifel. Er schien direkt aus dem achtzehnten Jahrhundert zu kommen. Und er war zweifellos nicht von Charlotte. Was mich jedoch in völlige Verwirrung stürzte, war der Umstand, daß die Verfasserin ihre Identität nicht preisgab. Ich kannte die Dame gar nicht, sie aber schien mich recht gut zu kennen. Oder hatte ich etwas übersehen? Mon cher Monsieur le Duc!
Was für eine Anrede! Hatte sich da jemand einen Spaß mit mir erlaubt? Sicher war es bekannt, daß einige Freunde mich »Jean-Duc« nannten, aber wer schrieb solche Briefe? Wort für Wort, als gälte es eine Geheimsprache zu entziffern, tasteten sich meine Augen an den blauen Schriftzeichen entlang, und ich hatte zum ersten Mal im Leben eine vage Vorstellung davon, wie mein archäologisch begabter Vorfahre sich gefühlt haben mußte, als er ratlos vor dem Stein von Rosette hockte.
Mon cher Monsieur le Duc! Ich weiß nicht, wie ich diesen Brief beginnen soll, der - ich fühle es mit der Gewißheit einer liebenden Frau - der wichtigste Brief meines Lebens ist.
Wie kann ich Ihre schönen blauen Augen, die mir so vieles über Sie verraten haben, denn nur dazu verführen, jedes meiner Worte aufzunehmen wie eine Kostbarkeit, sie einzulassen in Ihre Gedanken und Gefühle - in der hochfliegenden Hoffnung, daß diese kleinen Goldpartikel meines Herzens auch in Ihr Herz fallen mögen, um dort bis auf den Grund zu sinken für immer. Kann ich Sie damit beeindrucken, wenn ich Ihnen versichere, daß ich vom ersten Augenblick an gespürt habe, daß Sie, lieber Duc, der Mann sind, nach dem ich immer suchte?
Wohl kaum. Das werden Sie schon hundertmal gehört haben, und es ist wahrlich nicht sehr originell. Zudem, da bin ich mir sicher, wissen Sie aus Ihrer eigenen, nicht eben unerheblichen Erfahrung, wie oft die ach so gern herbeizitierte »Liebe auf den ersten Blick« bereits erschreckend kurze Zeit später großer Ernüchterung weicht.
Und dann - bliebe denn überhaupt noch ein Liebeswort oder ein leidenschaftlicher Gedanken für mich, der nicht schon einmal von einer anderen Person geschrieben oder gedacht wurde? Ich fürchte, nein.
Alles wiederholt sich, ist abgegriffen und wenig überraschend, wenn man es von außen betrachtet. Und dennoch erscheint alles neu, sobald man es am eigenen Leibe erfährt, und das Gefühl dabei ist so überwältigend schön, daß man glaubt, die Liebe selbst erfunden zu haben.
Aus diesem Grund müssen Sie es mir nachsehen, werter Herr, wenn ich ein weiteres Klischee bemühe, weil ich es selbst so und nicht anders erlebt habe - das berühmte erste Mal. Ich werde niemals den Tag vergessen, als ich Sie das erste Mal sah. Ihr Anblick, der mich wie ein Blitz traf, ein Blitz, der einschlägt, ohne daß es dabei gedonnert hätte! Ohne daß irgend jemand auch nur etwas bemerkt hätte.
Ich aber konnte kaum die Augen von Ihnen abwenden. Ihr nonchalantes und doch elegantes Auftreten faszinierte mich, Ihre funkelnden hellen Augen versprachen mir einen lebhaften Geist, Ihr Lächeln war für mich gemacht - und niemals sah ich schönere Hände an einem Mann. Hände, von denen ich, ich gestehe es errötend, bisweilen nachts mit offenen Augen träume.
Dennoch war dieser für mich so überaus glückliche Moment nicht gänzlich ungetrübt, denn an Ihrer Seite gab es eine schöne Frau, die alles andere überstrahlte wie eine Sonne und in deren Gegenwart ich mich fühlte wie eine unscheinbare Baronesse Trauerkleid. War es Ihre Frau? Ihre Geliebte?
Ängstlich und voller Eifersucht habe ich Sie beobachtet, lieber Duc, und ich fand bald heraus, daß Sie stets eine schöne Frau an Ihrer Seite hatten, auch wenn es - verzeihen Sie mir meine Direktheit - nicht immer dieselbe war ...
»Cochon! Blödes Schwein, verdammtes!« Es gab einen Ruck, und mein Taxifahrer wich mit quietschenden Bremsen einem Reisebus aus, der in rasanter Fahrt auf unsere Spur gewechselt war. Für einen winzigen Moment war ich mir nicht sicher, ob er vielleicht mich gemeint hatte. Ich nickte geistesabwesend.
»So ein Idiot, haben Sie das gesehen? Busfahrer! Alles selbstherrliche Idioten!« Der Taxifahrer ließ seine Hand auf die Kupplung klatschen, beschleunigte und zog an dem Reisebus vorbei. Nicht ohne heftig und mit eindeutigen Handzeichen aus dem heruntergelassenen Fenster zu gestikulieren. »Tu es le roi du monde, hein? Du bist der König der Welt, was?« rief er dem Busfahrer zu, der lässig abwinkte. Die Touristen, die ihre Stadt50 rundfahrt gebucht hatten, gafften beeindruckt zu uns herunter. So etwas bekam man in London nicht geboten.
Ich starrte sie an wie jemand, der gerade von einem anderen Stern auf die Erde gefallen ist und nichts versteht. Dann aber senkte ich den Kopf, ich kehrte wieder auf diesen Stern zurück, der mich auf geheimnisvolle Weise in seine Umlaufbahn gezogen hatte, und las weiter. ... und ich fand bald heraus, daß Sie stets eine schöne Frau an Ihrer Seite hatten, auch wenn es - verzeihen Sie mir meine Direktheit - nicht immer dieselbe war ...
Ich grinste, als ich die Worte erneut las. Wer auch immer das geschrieben hatte, besaß Humor. Darüber zu urteilen, warum dem so ist, steht mir nicht zu, dennoch hat es mich ermutigt, mich stündlich ein bißchen mehr in Sie zu verlieben, da Sie offenbar nicht gebunden sind, wie man so sagt.
Ich weiß nicht, wieviele Stunden seither vergangen sind - mir scheinen es tausende zu sein und dann doch wieder auch nur eine einzige, unendlich lange Stunde. Und auch wenn Ihr sorgloses Verhalten den Damen gegenüber darauf hinzudeuten scheint, daß Sie Herzensdinge nicht allzu ernst nehmen oder sich vielleicht nicht entscheiden können (oder wollen?), so sehe ich doch in Ihnen einen Mann mit tiefer Herzensbildung und überaus leidenschaftlichen Gefühlen, die - ich bin mir sicher - nur entflammt werden wollen von der richtigen Frau. Lassen Sie mich diese Frau sein, und Sie werden es nicht bereuen!
Ich denke immer noch mit klopfendem Herzen an diese eine unglückselige Geschichte zurück, die uns für wenige wunderbare Momente ganz nah zusammenbrachte, so nah, daß sich unsere Hände berührten und ich Ihren Atem auf meiner Haut spürte. Das Glück war einen Wimpernschlag entfernt, und ich hätte Sie so gerne geküsst. (Und es unter anderen Umständen vielleicht auch getan!) Sie waren so wunderbar durcheinander, und Sie haben sich so überaus ritterlich verhalten, obwohl mich mindestens genausoviel Schuld trifft, und dafür möchte ich Ihnen danken, auch wenn Sie im Moment sicherlich nicht einmal wissen, wovon ich spreche.
Nun werden Sie sich fragen, wer Ihnen da schreibt. Allein, ich werde es Ihnen nicht sagen. Noch nicht. Schreiben Sie mir zurück, Lovelace, und versuchen Sie es herauszufinden! Es könnte sein, daß ein amouröses Abenteuer auf Sie wartet, welches Sie zum glücklichsten Mann macht, den Paris jemals gesehen hat. Aber ich muß Sie warnen, lieber Duc. So leicht wie andere bin ich nicht zu haben. Ich fordere Sie also heraus zum zärtlichsten aller Duelle und bin gespannt, ob Sie diese kleine Herausforderung annehmen. (Ich möchte meinen kleinen Finger darauf verwetten, daß Sie es tun!) In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit den besten Wünschen, Die Principessa
»Wunderbar durcheinander« - dies sind wohl die Worte, die am treffendsten beschreiben, wie ich mich für den Rest des Tages fühlte.
Ich war nicht in der Lage, mich auf irgend etwas zu konzentrieren - nicht auf den Taxifahrer, der ungeduldig wurde, nachdem ich auch auf sein zweites »Nous sommes là, Monsieur, wir sind da!« nicht reagiert hatte, nicht auf Monsieur Tang, der mit fernöstlicher Geduld auf einem der Gleise mit den schönen Kugellampen wartete und freundlich lächelte, als ich zehn Minuten zu spät in die Gare du Nord stolperte, nicht auf das deliziöse Mittagessen, das ich mit meinem chinesischen Gast im Le Bélier einnahm, meinem Lieblingsrestaurant in der Rue des Beaux-Arts, wo man in roten Samtsesseln und in wahrhaft fürstlichem Ambiente ißt und die Speisekarte in ihrem minimalistischen Understatement mich jedesmal aufs neue begeistert.
Auch an diesem Tag hatte man die Wahl zwischen »la viande«, dem Fleisch, »le poisson«, dem Fisch, »les légumes«, dem Gemüse und »le dessert«, dem Nachtisch. Einmal hatte ich als Vorspeise sogar schlicht und ergreifend »l'oeuf«, das Ei gewählt und das sehr sophisticated gefunden. Die Übersichtlichkeit und Qualität der Speisen überzeugten auch meinen chinesischen Freund, der sich anerkennend äußerte und mir dann begeistert über den boomenden Kunstmarkt im Land des Lächelns erzählte und von seinem letzten »Coup« in einem belgischen Auktionshaus schwärmte. Monsieur Tang, ist das, was man einen collectionneur compulsif nennt, und ich hätte mich wirklich etwas mehr ins Zeug legen können. Statt dessen schob ich zerstreut meine légumes auf dem Teller herum und fragte mich, warum nicht alles im Leben so einfach sein konnte, wie die Menu-Karte im Le Bélier.
Immer wieder kehrten meine Gedanken zu dem rätselhaften Schreiben zurück, das zusammengefaltet in meiner Jackentasche steckte. Noch nie hatte ich einen solchen Brief erhalten, einen Brief, der mich gleichermaßen provozierte und berührte und der mich - um es mal in der Sprache der Principessa zu sagen - in unaussprechliche Verwirrung stürzte.
Wer, zum Teufel, war diese Principessa, die mir mit zärtlichen Worten die wunderbarsten amourösen Abenteuer in Aussicht stellte und mich zugleich maßregelte wie einen kleinen Jungen und mit »den besten Wünschen « auf eine Antwort von mir wartete?!
Als Monsieur Tang aufstand und sich mit einer kleinen Verbeugung in meine Richtung für einen Moment entschuldigte, um die Örtlichkeiten des Restaurants aufzusuchen, nutzte ich die Gelegenheit, um den himmelblauen Brief noch einmal aus meiner Tasche hervorzuziehen. Wieder vertiefte ich mich in die Zeilen, die mir inzwischen schon so vertraut vorkamen, als hätte ich sie selbst geschrieben.
Ein leises Scharren ließ mich zusammenzucken wie einen Dieb, der beim Klauen erwischt wird. Monsieur Tang, der lautlos wie ein Tiger zurückgekehrt war, rückte seinen Sessel zurecht, und ich lächelte ertappt, faltete die Briefbögen rasch zusammen und steckte sie in meine Jackentasche.
»Oh, bitte verzeihen Sie.« Monsieur Tang schien unglücklich über seine vermeintliche Indiskretion. »Ich wollte Sie nicht stören. Bitte, lesen Sie doch zu Ende.« »Aber nein, aber nein«, entgegnete ich und grinste schafsköpfig. »Es ist nur ... Meine Mutter hat geschrieben ... Ein Familienfest ...« Meine Güte, was für einen Schwachsinn erzählte ich da? Ein gütiger Gott hatte ein Einsehen und schickte den schwarzgekleideten Kellner, der uns fragte, ob wir noch einen Wunsch hätten. Dankbar bestellte ich le dessert, der sich als Crème brulée entpuppte, und zwang mich, Monsieur Tang, der mit dem ihm eigenen chinesischen Familiensinn verständnisvoll nickte, ein paar Fragen zu stellen.
Während ich mit ein paar »Aaahs« und »Ooohs« Interesse an seinen Ausführungen zur Tulpenmanie im Holland des siebzehnten Jahrhunderts heuchelte (wie war er auf dieses Thema gekommen?), kreisten meine Gedanken um die Identität der schönen Briefeschreiberin. Es mußte eine Frau sein, die ich kannte. Oder doch zumindest eine, die mich kannte. Aber in welchem Zusammenhang? Es mag unbescheiden klingen, aber mein Leben ist voller Frauen. Man begegnet ihnen praktisch überall. Man flirtet mit ihnen, diskutiert mit ihnen, arbeitet mit ihnen, lacht mit ihnen, verbringt viele Stunden im Café mit ihnen, und dann und wann, wenn mehr daraus wird, auch die Nächte.
Dieser Brief jedoch bot so gar keine konkreten Anhaltspunkte, aus denen ich hätte schließen können, wer die kapriziöse Verfasserin war. Und kapriziös war sie, so viel hatte ich begriffen. Ganz unten auf der Rückseite des Briefes hatte ich eben eine E-Mail-Adresse entdeckt: principessa@google- mail.com.
Alles äußerst rätselhaft. Die Geheimniskrämerei der Principessa machte mich auf sonderbare Weise wütend, dann wieder kamen mir all ihre wunderbaren Worte in den Sinn, und ich war bezaubert.
»Monsieur Champollion, Sie sind nicht bei der Sache «, rügte mich Tang freundlich. »Ich habe Sie gerade gefragt, was Soleil Chabon macht, und Sie antworten ›Hmm ... ja, ja‹.«
Himmel, ich mußte mich endlich zusammenreißen! »Ja ... ich ... äh ... Kopfschmerzen«, stotterte ich und faßte mir an die Stirn. »Dieses Wetter macht mir zu schaffen.« Draußen schien eine milde Maisonne, und die Luft war klar wie selten in Paris.
Tang zog die Augenbrauen hoch, untersagte sich aber höflich jeden Kommentar. »Und Soleil? - Sie wis56 sen doch, diese junge karibische Malerin«, setzte er erklärend hinzu, offenbar hatte er kein großes Vertrauen mehr in meine kombinatorischen Fähigkeiten. »Aaah - Soleil!« Ich lachte ein wenig gequält, als mir einfiel, daß ich versprochen hatte, heute noch (heute noch?!) bei meiner liebeskranken Schwarzmalerin vorbeizuschauen. »Soleil ... erlebt gerade ihren schöpferischen Urknall«, erklärte ich und fand, daß das in Anbetracht ihrer explosiven Verfassung gar nicht mal gelogen war. »Im Juni macht sie ihre zweite Ausstellung, Sie kommen doch auch, oder?«
Tang nickte lächelnd, und ich bestellte die Rechnung. Nach einem anstrengenden Nachmittag in den Räumen der Galerie du Sud, wo uns Marion und Cézanne freudig begüssten und mein Chinese sich mit unbeirrbarem Lächeln alle neuen Bilder zeigen ließ, wobei seine Kommentare von »tlès intelessant« bis »supelbon« reichten, zog er endlich mit ein paar Prospekten und seinem kleinen silbernen Rollkoffer ins Hôtel des Marronniers ab, einem charmanten, kleinen Hotel, das praktischerweise in der Rue Jacob, also gleich bei mir um die Ecke liegt und das Europäer wie Asiaten gleichermaßen begeistert.
Die Lage ist unbezahlbar. Ruhig, im Herzen von Saint-Germain, mit einem Innenhof, der mit duftenden Rosen bewachsen ist und in dessen Mitte ein alter Brunnen leise plätschert. In dieser Jahreszeit das Non57 plusultra für romantisch veranlagte Menschen, die vom vierten Stock aus sogar auch noch den Blick auf die Kirchturmspitze von St-Germain-des-Prés haben können. Nur sollten sie nicht zu groß gewachsen sein.
Die Zimmer haben stoffbespannte Wände, antike Möbel - und sie sind klaustrophobisch klein. Nichts für den Durchschnittsamerikaner aus dem Mittleren Westen also, denn bei einer Körperlänge von über einem Meter achtzig ist der Liegekomfort erheblich eingeschränkt. Da ich kein Hüne von Mann bin, betrifft mich dieses Problem nicht persönlich, doch ich habe vor Jahren einmal den Fehler begangen, Jane Hirstman und Bob, ihren neuen Zwei-Meter-Mann und Lebensgefährten, im Marronniers einzuquartieren. Noch heute ist Bob, der normalerweise allein ein Kingsize-Bett ausfüllen kann, traumatisiert von seinem »romantic desaster« in dem »Little Snow-White-Zwergen-Bettchen«.
Mit einem Seufzer ließ ich mich in mein weißes Sofa fallen und kraulte gedankenverloren Cézannes weichen Nacken. Der Schlafmangel der letzten Nacht holte mich allmählich ein, ganz zu schweigen von den Aufregungen der letzten Stunden, so schön sie auch waren. Marion war vor zehn Minuten von ihrem Harley- Davidson-Typ abgeholt worden, und ich hatte den ersten ruhigen Moment. Zum dritten Mal an diesem Tag zog ich den Brief der Principessa hervor und strich die zerknitterten Seiten glatt. Dann rief ich Bruno an.
Wenn das Leben eines Mannes aus welchem Grund auch immer unübersichtlich zu werden droht, braucht er vor allem drei Dinge: einen ruhigen Abend in seiner Lieblingskneipe, ein Glas Rotwein und einen guten Freund.
Auch wenn ich am Telefon keine großen Worte machte, sondern nur etwas in der Art wie »Sollen wir einen trinken gehen, ich muß dir was erzählen« sagte, verstand Bruno sofort.
»Gib mir eine Stunde«, sagte er, und allein der Gedanke an diesen großen, bodenständigen Mann in seinem weißen Kittel hatte etwas ungemein Beruhigendes. »Ich hol dich in der Galerie ab.«
Bruno ist Arzt, seit sieben Jahren verliebt in seine Frau Gabrielle und begeisterter Vater einer dreijährigen Tochter. Wenn er nicht gerade gebrochene oder zu große Nasen richtet und den Damen der Pariser Gesellschaft mit Botoxinjektionen die zerfurchte Stirn glättet, ist er auch leidenschaftlicher Gärtner, Hypochonder und Verschwörungstheoretiker. Er bewohnt mit seiner Familie eine Gartenwohnung in Neuilly, hat eine gut gehende Praxis an der Place Saint-Sulpice und kann mit moderner Kunst ebensowenig anfangen wie mit experimenteller Literatur. Und er ist mein bester Freund. »Danke, daß du gekommen bist«, sagte ich, als er eine Stunde später die Galerie du Sud betrat. »Schön, dich zu sehen.« Er klopfte mir auf die Schulter und ließ seinen professionellen Ärzteblick über mich laufen. »Du hast nicht viel geschlafen und wirkst etwas aufgekratzt«, lautete die Gratisdiagnose. Während ich meinen Regenmantel holte, blätterte Bruno angelegentlich durch einen Ausstellungskatalog von Rothko, der auf dem Couchtisch lag. »Was findest du nur an dem Zeug?« fragte er kopfschüttelnd. »Zwei Rechtecke in Rot - das könnte ich dir auch noch malen.«
Ich grinste. »Um Gottes willen, bleib lieber bei deinen Nasen«, entgegnete ich und schob ihn in Richtung Tür. »Die Wirkung eines Kunstwerks kann man sowieso erst dann ermessen, wenn man selbst vor dem Bild steht und merkt, ob es etwas mit einem macht. Viens, Cézanne! « Ich trat nach draußen, schloß die Tür der Galerie ab und ließ das Eisengitter herunter.
»So ein Quatsch! Was soll denn ein rotes Rechteck mit mir machen?« Bruno schnaufte verächtlich. »Ja, wenn es wenigstens die Impressionisten wären, da laß ich mich gerne überzeugen, aber dieses ganze Geschmiere heutzutage ... ich meine, woran willst du denn heute ›Kunst‹ erkennen? « Man konnte die Anführungszeichen direkt hören. »Am Preis«, entgegnete ich trocken. »Sagt jedenfalls Jeremy Deller.« »Wer ist Jeremy Deller?« »Ach, Bruno, komm, vergiß es einfach! Laß uns ins La Palette gehen. Es gibt im Leben Wichtigeres als moderne Kunst.« Ich machte die Leine an Cézannes Halsband fest, der mich so treu ansah, als bezöge er den letzten Satz auf sich.
»Da bin ich ganz d'accord«, erklärte Bruno und klopfte mir zufrieden auf die Schulter. Gemeinsam marschierten wir durch den lauen Abend im Mai, bis wir zu meinem kleinen Lieblingsbistro am Ende der Rue de Seine kamen, wo die Wände mit Bildern behängt sind, die nicht Bekehrbaren bei jeder Temperatur draußen an den kleinen runden Tischchen sitzen und rauchen und der stämmige Wirt mit jedem halbwegs schönen Mädchen scherzt und behauptet, in einem früheren Leben mit ihm zusammengewesen zu sein. Ich atmete tief durch. Egal, was das Leben für einen bereit hielt - es war schön, einen guten Freund zu haben.
Eine Stunde später dachte ich nicht mehr, daß es schön war, einen guten Freund zu haben. Ich saß bei einer Flasche Rotwein mit Bruno an einem der dunklen Holztische, und wir diskutierten so heftig, daß einige der Gäste erstaunt zu uns herüberschauten. Eigentlich hatte ich nur einen Rat gewollt. Ich hatte Bruno vom gestrigen Abend erzählt, von der verunglückten Liebesnacht mit Charlotte, dem Panikanruf von Soleil - und natürlich von dem seltsamen Liebesbrief, der schon den ganzen Tag meine Gedanken beschäftigte. »Ich hab nicht die leiseste Ahnung, wer den Brief geschrieben haben könnte. - Was meinst du, soll ich antworten? « hatte ich gefragt und wollte eigentlich ein »Ja« hören.
Statt dessen runzelte Bruno die Stirn und fing mit irgendwelchen verschwörungstheoretischen Überlegungen an. Es sei bedenklich und äußerst verdächtig, daß die Verfasserin des Briefes sich nicht zu erkennen gebe, meinte er. Anonyme Briefe solle man grundsätzlich nicht beantworten, da liege kein Segen drauf. »Wer weiß, was für eine Psychopathin dahintersteckt. « Er beugte sich mit verschwörerischem Blick vor. »Kennst du diesen Film mit Audrey Tautou, wo sie eine durchgeknallte Stalkerin spielt, die sich diesen netten verheirateten Mann ausgeguckt hat, dessen Frau schwanger ist, und der nachher im Rollstuhl landet, weil sie ihm eine schwere Vase auf den Kopf knallt, als er sie abweist?«
Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Auf so eine Idee war ich noch gar nicht gekommen. »Nö«, entgegnete ich lahm. »Ich kenne nur ›Die fabelhafte Welt der Amélie‹, und da wird am Ende alles irgendwie gut.« Bruno lehnte sich zufrieden zurück. »Mein armer Freund, ich kenne die Frauen, und ich sage: Vorsicht.« »Nun ja«, wandte ich ein. »Auch ich kenne die Frauen ein wenig.«
»Aber nicht solche Frauen.« Bruno flüsterte fast. »Ich sehe doch, was tagaus, tagein in meiner Praxis ein- und ausgeht. Glaub mir, die meisten haben eine Macke. Die eine hält sich für die Königin der Nacht, die andere für eine Principessa. Keine will alt werden, und alle finden sich zu dick. Und erinnerst du dich noch an diese auf62 sässige Frau, der ich die Nase operiert habe und die mich dann Tag und Nacht am Telefon tyrannisiert hat, weil sie sich einbildete, ich hätte mich in sie verliebt?« Bruno sah mich bedeutungsvoll an. »Weißt du, wie Frauen sein können, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben? Antworte ihr, und du wirst sie nicht mehr los!«
»Also, wirklich, Bruno, du übertreibst. Das ist der Brief einer Frau, die sich offensichtlich in mich verliebt hat. Was soll daran so psychopathisch sein? Außerdem hat der Brief überhaupt nichts Zwanghaftes. Es ist eher ein ... ein charmantes, um nicht zu sagen unwiderstehliches Angebot.« Ich bekräftigte meine Worte mit einem großen Schluck Rotwein und bestellte einen salad au chèvre. Die Diskussion hatte mich hungrig gemacht. »Ein charmantes Angebot, hmmm ...« Nachdenklich wiederholte Bruno meine Worte. »Was natürlich auch sein könnte ...«, begann er, und ich stöhnte innerlich auf. Während ich meinen Salat aß, entwickelte Bruno eine neue Theorie, die mich fast meinen warmen Ziegenkäse verschlucken ließ.